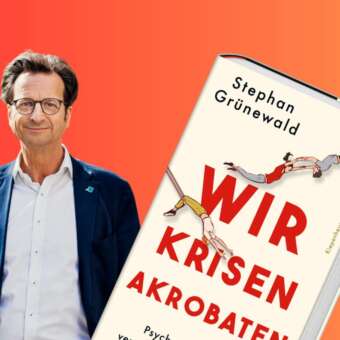Es ist ein Abend über Krisenakrobatik, Verbundenheit und die Kunst, Krisenenergie in Aufbruch zu verwandeln. Zu Beginn der Sendung stellt Markus Lanz den rheingold Gründer Stephan Grünewald vor – und findet sehr anerkennende Worte für sein neues Buch „Wir Krisenakrobaten“, indem er den rheingold-Ansatz sowie rheingold-Studien – insbesondere Gesellschafts- und Kulturstudien – verarbeitet:
„Stephan Grünewald, der gerade ein sehr lesenswertes, weil in Teilen wirklich sehr originelles Buch veröffentlicht hat: Wir Krisenakrobaten. Im Buch beschreibt er, was in den Deutschen wirklich vor sich geht.“
Mit dieser Setzung war der Ton für die Diskussion bereits markiert: Es ging um die seelische Verfassung des Landes, um die Frage, wie wir miteinander sprechen, streiten und Zukunft gestalten – nicht nur politisch, sondern auch psychologisch.
Resonanzraum für gesellschaftliche Debatte
Die Sendung war als weite Perspektivbewegung angelegt. Melanie Amann, Journalistin, berichtete von ihren Aufenthalten an US-Eliteuniversitäten und beschrieb eine Atmosphäre der Vorsicht, in der offene Debatte zunehmend durch Strategien der Selbstabsicherung ersetzt wird. Susanne Kaiser, zugeschaltet aus Buenos Aires für die Konrad-Adenauer-Stiftung, schilderte, wie Argentinien unter Präsident Milei trotz gesellschaftlicher Verwerfungen eine bemerkenswerte ökonomische Stabilisierung erlebt – allerdings um den Preis sozialer Härten. Karl-Theodor zu Guttenberg wiederum richtete den Blick auf die Frage, wie demokratische Parteien in Deutschland mit dem Wachstum der AfD umgehen sollten: mit klarer Abgrenzung, aber ohne reflexhafte Reiz-Reaktionen.
Bedürfnis nach Zugehörigkeit
Diese drei Perspektiven öffneten einen Resonanzraum, in dem sich die Themen Meinungsfreiheit, politische Lagerbildung und gesellschaftliche Belastungen ineinander verschränkten. Auf dieser Grundlage konnte Stephan Grünewald die psychologische Komponente dieser Entwicklungen herausarbeiten und sichtbar machen, wie sie sich im Erleben der Menschen spiegeln: im Rückzug, im Schweigen, im Bedürfnis nach Halt und Zugehörigkeit.
Ein zentrales Motiv ist der Rückzug ins Private. Viele Menschen erleben die Vielzahl globaler Herausforderungen – Krieg, Migration, Klimawandelfolgen – als kaum steuerbar. Das führt zu Ohnmacht und einem Rückzug aus dem öffentlichen Raum in vertraute und kontrollierbare Lebensbereiche. Kurzfristig wirkt das stabilisierend, langfristig entsteht eine „gestaute Bewegungsenergie“, so Grünewald: die diffuse Gewissheit, dass eigentlich Veränderung nötig wäre, wir aber nicht recht ins Handeln kommen.
Krise der Verbundenheit
Damit verbunden ist die von Grünewald beschriebene Krise der Verbundenheit. In Gesprächen erweise sich, dass Menschen Kontakte vermeiden, in denen sie mit Gegenpositionen konfrontiert wären. Stattdessen entstehen geschlossene Resonanzräume – Grünewald nennt das „Silodarität“. Man bleibt verbunden, aber nur mit denjenigen, die ohnehin ähnlich denken. Das schwächt eine Gesellschaft in ihrer Fähigkeit zur produktiven Auseinandersetzung.
Gestaute Ausdrucksbildung junger Menschen
Besonders junge Menschen spüren diese Entwicklung. In digitalen Räumen, in denen Sichtbarkeit und Bewertung eng miteinander verwoben sind, führt die Angst vor sofortiger Kritik häufig zu Selbstzensur. Grünewald spricht bei Lanz von einer „gestauten Ausdrucksbildung“: Haltung wird nicht mehr gezeigt, aus Sorge, sie könnte angreifbar sein.
Vor diesem Hintergrund gewinnt die Frage nach einer zeitgemäßen Streitkultur an Bedeutung. Grünewald erinnert daran, dass gutes Streiten früher selbstverständlich zur Beziehung gehörte: Man stritt hart, aber blieb verbunden. Es braucht wieder Orte und Rituale, die erlauben, Positionen offen auszutauschen – und danach weiter gemeinsam am Tisch zu sitzen.
Auch politisch leitet sich daraus ab, dass wenige, gut verständliche Prioritäten gesetzt werden müssen. Veränderung wird anschlussfähig, wenn Menschen sich als handlungsfähig erleben. Grünewald nennt den ersten Energiesparwinter als Beispiel dafür, wie ein kollektiver Kraftakt hätte markiert und bestärkt werden können.
Gesprächsbereitschaft gegenüber verunsicherten Wählern
In der Diskussion um den Umgang mit der AfD betonte er die Notwendigkeit einer klaren Unterscheidung: entschiedene Abgrenzung gegenüber extremistischen Positionen – und gleichzeitig offene Gesprächsbereitschaft gegenüber verunsicherten Wählerinnen und Wählern. Ausgrenzung allein verstärkt das Gefühl des Verlorenseins. Gespräch schafft Möglichkeiten, Zugehörigkeit wieder erfahrbar zu machen.
So zeichnete der Abend ein Bild, das weder dramatisierte noch beschönigte: Die gesellschaftliche Energie ist vorhanden. Sie wartet darauf, gebündelt, gerichtet und gemeinsam genutzt zu werden.
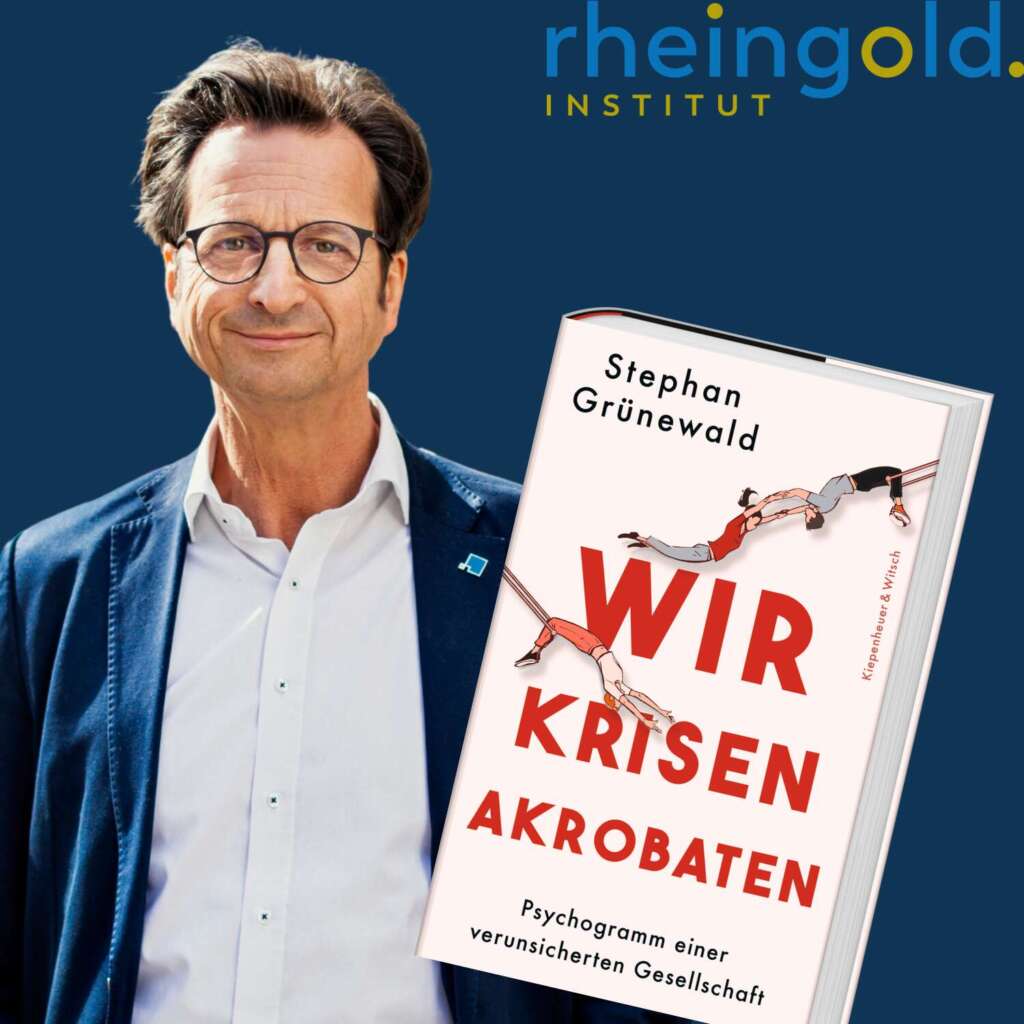
Buchhinweis:
Stephan Grünewald: Wir Krisenakrobaten. Psychogramm einer verunsicherten Gesellschaft.
Kiepenheuer & Witsch, 24,00 €.
Auf Grundlage mehrerer tausend zweistündiger Tiefeninterviews zeichnet Stephan Grünewald ein psychologisches Stimmungsbild der Gegenwart.