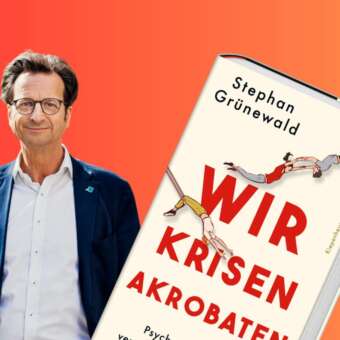Auf den ersten Blick versteht man es nicht. Wirklich nicht.
Eine Figur, die aussieht wie eine Mischung aus Troll, Hase und Dämon – mit riesigen Augen und schrägem Grinsen. Und trotzdem: Labubu ist ein globaler Hype. Popstars tragen ihn, TikTok-Feeds explodieren vor Unboxing-Videos, ganze Sammlergemeinden campieren vor Pop-Mart-Filialen, um an limitierte Editionen zu kommen.
Warum?
Weil wir es mit einem Trend zu tun haben, der sich nicht über den oberflächlichen Nutzen erklärt – sondern über tiefere psychologische und kulturelle Bedürfnisse. Und weil Labubu, so seltsam er auf den ersten Blick wirkt, die Grammatik der heutigen TikTok-Ökonomie perfekt spricht.
Der Labubu-Hype als System
Labubu ist kein Zufallsphänomen. Die chinesische Firma Pop Mart, die hinter dem Vertrieb steht, nutzt ein hochentwickeltes System emotionaler Aktivierung:
- Blindboxing: Man weiß beim Kauf nicht, welche Figur man bekommt. Das weckt Hoffnung, Spieltrieb – und einen unterschwelligen Nervenkitzel, der psychologisch dem Prinzip von Low-Stakes-Gambling ähnelt.
- Social-Media-Kompatibilität: Das Unboxing – also der Moment des Auspackens – wird zum viralen Content. Die echten, ungefilterten Reaktionen der Käufer:innen erzeugen Authentizität. So entsteht Reichweite aus Emotion.
- Künstliche Verknappung: Limitierte Auflagen, ausverkaufte Serien und Warteschlangen erzeugen Begehrlichkeit. Wer einen Labubu ergattert, zeigt damit: Ich gehöre dazu.
So entsteht ein ökonomisch klug orchestrierter Kreislauf aus Konsum, Status und Community. Aber das allein erklärt den Trend nicht.
Die Sehnsucht hinter dem Labubu-Sammeltrieb
Labubu wäre nicht so erfolgreich, wenn er nur als cleveres Geschäftsmodell funktionieren würde. Seine tiefere Wirkung liegt in seiner symbolischen Bedeutung. Er steht für eine neue Form des Trosts – vor allem für junge Menschen, die in einer Welt voller Unsicherheit, Klimakatastrophen, sozialer Spannungen und überfordernder Komplexität leben.
Labubu ist ein Produkt der sogenannten Kawaii-Mentalität: einer Ästhetik, die in den 1970ern in Japan entstand – süß, weich, verletzlich, aber nicht wehrlos.
„Ich bin anders. Ich bin zart. Ich brauche Schutz – aber ich kann auch beißen.“
Diese Ambivalenz macht Labubu anschlussfähig für die Generation Z und die jungen Millennials, die gelernt haben, sich nicht nur über Leistung, Härte oder Abgrenzung zu definieren, sondern über Sensibilität, Ambivalenz und subtile Widerständigkeit.
Die kulturellen Wurzeln von Kawaii
Was heute als popkulturelle Ästhetik rund um Hello Kitty, Pastelltöne oder Plüschmaskottchen erscheint, begann ursprünglich als stiller Protest. In den 1970er-Jahren entwickelten japanische Schulmädchen einen verspielten Handschriftstil – mit Herzchen, Smileys und runden Buchstaben – um Individualität und Emotionalität auszudrücken.
Es war eine Form der zarten Gegenwehr gegen das strenge, leistungsorientierte Bildungssystem und die gesellschaftlichen Konformitätsanforderungen.
Nach dem wirtschaftlichen Aufschwung suchten viele junge Menschen in Japan nach einer freundlichen, sanften Gegenwelt zur reglementierten Erwachsenenwelt. Unternehmen wie Sanrio erkannten das Potenzial und machten Figuren wie Hello Kitty weltweit erfolgreich.
Anime-Serien, Mangas und Spielwaren exportierten den Stil – und das Lebensgefühl – ab den 1980er-Jahren global.
Doch Kawaii ist bis heute mehr als ein Look: Es wurde zu einem kulturellen Code – ein Ausdruck von Unschuld, Harmonie und Verletzlichkeit in einer Gesellschaft, die oft Härte und Effizienz verlangt. Auch viele Erwachsene greifen bewusst zu Kawaii-Elementen, etwa in Form von Firmenmaskottchen, um Nähe und emotionale Zugänglichkeit zu signalisieren. Kawaii verbindet Konsum mit Identität, Nostalgie mit Rebellion. Labubu steht in dieser Tradition – aber aktualisiert sie für die digitale Ära.
Der kleine Labubu-Luxus für große Krisen
Psychologisch betrachtet erfüllt Labubu auch den sogenannten „Lipstick-Effekt“: In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit und schwindender Zukunftsperspektiven leisten sich Menschen keine großen Dinge mehr – sondern kleine, emotional aufgeladene Käufe.
Ein Labubu ist ein solches Objekt: bezahlbar, besonders, tröstlich. Er gibt das Gefühl, sich selbst etwas Gutes zu tun – in einer Welt, die oft nicht gut erscheint.
Manche Erwachsenen greifen dabei bewusst zu Symbolen der Kindheit. In der Marktforschung sprechen wir von „Kidults“: Erwachsene, die sich kindliche Freuden bewahren, als Gegengewicht zur Ernsthaftigkeit des Alltags. Für sie ist Labubu kein Spielzeug – sondern ein Safe Space.
TikTok-Nation, Trost und stille Rebellion
Der Labubu-Trend ist darüber hinaus auch Ausdruck einer kollektiven Stimmungslage. Viele junge Menschen erleben die Gegenwart als chaotisch und ungerecht. Labubu wird so auch zum stillen Hilferuf: Ich bin süß, aber auch schräg. Ich bin verletzlich, aber auch wehrhaft.
Ich wünsche mir Rücksicht – und bin bereit, Widerstand zu leisten.
Labubu verkörpert damit eine neue Form von Subversion verpackt in Plüsch. Ein Anti-Produkt, das gleichzeitig massentauglich ist. Eine ironische Umarmung des Hässlichen, das dadurch liebenswert wird. Und ein kulturelles Symbol, das auf den ersten Blick infantil wirkt, aber auf den zweiten Blick ein sehr erwachsener Kommentar zur Gegenwart ist.
Der Labubu-Hype entfaltet seine Kraft, weil er zentrale psychologische Bedürfnisse der jungen Generation trifft. In einer Welt, die von Klimakatastrophen, Kriegen und sozialer Spaltung geprägt ist entsteht das Gefühl, dass all das vor allem auf dem Rücken der Schwächsten ausgetragen wird. Daraus erwächst die Sehnsucht nach Schutz, Sinn und Trost.
Labubu wird so zu einem Symbol für ein unbewusstes Lebensgefühl: der Wunsch, das Schützenswerte zu bewahren – und die stille Drohung, sich zu entziehen, wenn das nicht geschieht. Nicht durch lauten Protest, sondern durch Rückzug, Konsumverweigerung, Boykott oder schlichtes Desinteresse.
Der Hype ist ein Hilfeschrei an die Gesellschaft, an die Entscheidungsträger: „Bitte passt wieder auf das Schützenswerte auf. Und gleichzeitig, seid gewarnt: Wir haben auch Zähne. Wir werden uns wehren.“ Der Hype um Labubu ist damit auch ein Appell an Unternehmen, Institutionen und Politik: Achtet auf das Verletzliche – oder riskiert, das Vertrauen einer ganzen Generation zu verlieren.
Und wie geht der Labubu Hype weiter?
Ob Labubu bleibt, hängt von mehreren Faktoren ab:
Kann Pop Mart neue Figuren entwickeln, überraschende Erzählwelten anbieten, das Momentum halten? Oder wird der Hype zum Mainstream und verliert seine kulturelle Sprengkraft?
Eines aber steht fest: Labubu hat etwas berührt. Und damit etwas sichtbar gemacht, das in vielen Markenstrategien heute noch übersehen wird:
Es geht nicht nur um Produktnutzen. Es geht um emotionale Anschlussfähigkeit. Um kulturelle Resonanz. Um psychologische Tiefe.
In der TikTok-Ökonomie gewinnen nicht die Lautesten. Sondern die, die mit scheinbar beiläufigen Gesten das Richtige auslösen. Labubu tut genau das.
Das Wichtigste über den Labubu-Hype in Kürze:
- Labubu ist globaler Hype: Pop Mart nutzt Blindboxing, Social Media und künstliche Verknappung, um Begehrlichkeit und Community zu schaffen.
- Psychologische Wirkung: Labubu steht für Trost und Schutz in unsicheren Zeiten, besonders für Gen Z und junge Millennials.
- Kultureller Code: Verwurzelt in der Kawaii-Ästhetik: süß, verletzlich, ambivalent und zugleich subversiv.
- Konsum in der Krise: Labubu erfüllt den „Lipstick-Effekt“: kleine Käufe mit großer emotionaler Aufladung, auch für Erwachsene („Kidults“).
- Gesellschaftlicher Kommentar: Die Figur wird zum Symbol stiller Rebellion und Hilferuf einer Generation, die Schutz und Rücksicht fordert.
- Lehre für Marken: In der TikTok-Ökonomie zählt nicht Lautstärke, sondern emotionale Anschlussfähigkeit und kulturelle Resonanz.
Über die Autoren:
Stephan Urlings ist Managing Partner des rheingold Instituts und Head of International Research.
Wutao Wen ist Head of Asia Research am rheingold Institut.