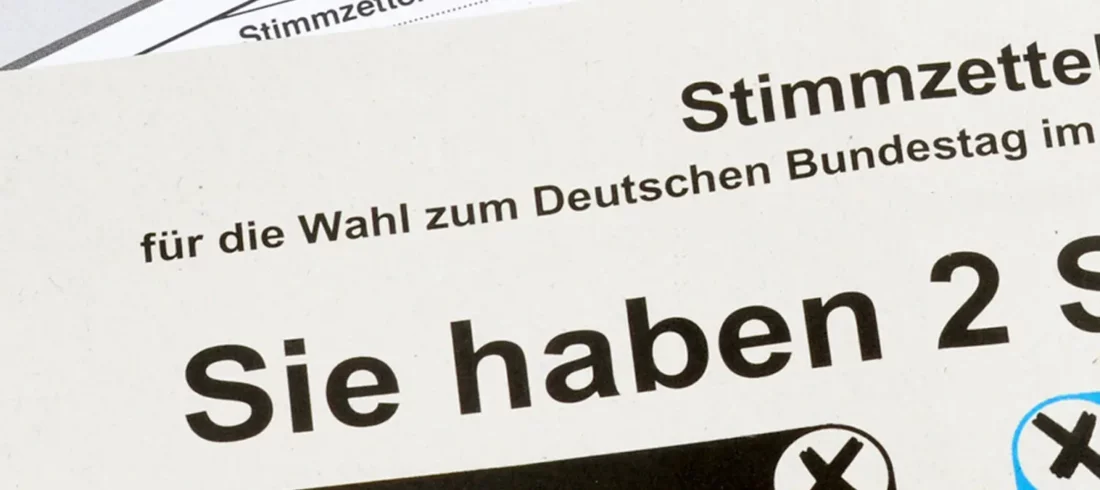Politiker*innen sollen stellvertretend seelisches Dilemma auflösen
Ergebnisse der tiefenpsychologischen rheingold-Studie zur Bundestagswahl 2021
Die krisengeschüttelten Wählerinnen und Wähler sind sechs Wochen vor der Wahl vordringlich damit beschäftigt, ihren Alltag in den Griff zu kriegen. Statt Aufbruchs-Stimmung überwiegt der Rückzug ins eigene Schneckenhaus. Die sich jenseits des Privaten auftürmenden globalen und nationalen Probleme und Jahrhundert-Herausforderungen stürzen die Menschen in ein fatales Machbarkeits-Dilemma. Einerseits realisieren sie spätestens seit der Flutkatastrophe, dass große Veränderungen anstehen, um nicht nur die Klimakrise bewältigen zu können. Die Wählerinnen und Wähler schrecken jedoch vor den damit verbundenen Einschränkungen und Anstrengungen zurück.
Bezüglich der Wahl haben die Menschen ambivalente Strategien entwickelt, um das persönliche Machbarkeits-Dilemma aufzulösen. „Einerseits suchen sie eine Kandidatin oder einen Kandidaten, der die bevorstehende Herkulesaufgabe annimmt und sie kraftvoll aus den Problemen herausführt“, analysiert Stephan Grünewald, „andererseits konstatieren sie mit einer Mischung aus Enttäuschung und Erleichterung, dass es solch eine Führungsgestalt eben nicht gibt und weder Annalena Baerbock noch Armin Laschet oder Olaf Scholz dieser Aufgabe gewachsen ist.“ Mitunter werden die Kandidaten und Kandidat*innen regelrecht kleingeredet: „Annalena Baerbock, hat es verbockt, Laschet ist zu lasch und Scholz zu stolz,“. Die vermeintliche Schwäche der Kandidat*innen entbindet die Wähler*innen davon, selbst Stärke und Konsequenz angesichts der riesigen Herausforderungen zeigen zu müssen.
Das unwiderrufliche Ende der Merkel-Ära mit ihrem beruhigenden „Weiter so“ verstärke den ohnehin bereits schon verspürten enormen Veränderungsdruck und das aktuelle Machbarkeits-Dilemma, so Grünewald weiter. Die Kandidaten und die Parteien würden weniger im Hinblick auf konkrete Inhalte und Programmatiken wahrgenommen. Sie repräsentierten vielmehr unterschiedliche Strategien im Umgang mit dem Machbarkeits-Dilemma.
Dezidierte Wahlprognosen sind nach den Ergebnissen der Studie daher fast unmöglich. Viele Wähler*innen steckten in ihrem inneren Dilemma fest – die Festlegung auf eine Partei und damit einen möglichen Lösungsweg verlange ihnen zu viel Entschiedenheit ab. „Wie bei keiner Wahl zuvor denken die Bürger*innen daher in Koalitionen, viele würden ihre Stimmen am liebsten splitten“, erklärt Grünewald.
Zur Stichprobe und Methode der Studie:
rheingold führt seit 2002 regelmäßig ca. 6 – 8 Wochen vor der Bundestagswahl eine Eigenstudie durch. Im Rahmen dieser Studie werden jeweils 50 Wähler*innen sinnbildlich auf die Couch gelegt: In zweistündigen psychologischen Tiefeninterviews und Gruppendiskussionen werden sie intensiv danach gefragt, wie sie die Stimmung im Land und den Wahlkampf erleben.
Die tiefenpsychologische Studie ist als qualitative Studie im statistischen Sinne nicht repräsentativ. Sie verfolgt jedoch das Ziel, die wesentlichen Aspekte, Bedeutungsmomente und Motivationen zu repräsentieren, die den aktuellen Wahlkampf und die derzeitige Haltung der Wähler*innen bestimmen. Dabei stellt sie keine prozentuale Wahlprognose, sondern liefert Verstehens-Hintergründe, indem sie das Stimmungsbild im Land nachzeichnet und beschreibt, was die Wähler*innen bewusst oder unbewusst beschäftig und wie sie Parteien und Politiker*innen wahrnehmen.
Bei der Auswahl der Proband*innen wird darauf geachtet, dass Parteipräferenzen und soziodemographische Strukturen (Geschlechter, regionale Verteilung, Altersverteilung, Bildung und Beruf) möglichst genau abgebildet werden. Die Tiefen-Explorationen werden von einem fünfköpfigen Psycholog*innen-Team durchgeführt und analysiert.
Die Ergebnisse der rheingold-Studie im Detail:
Die Wähler*innen befinden sich derzeit nicht in Aufbruch-Stimmung! Den Wahlkampf erleben viele als ein fernes und entrücktes Geschehen, das kaum wahrgenommen wird und die Bürger*innen nicht wirklich packt und tangiert. Nach eineinhalb Jahren Corona-Krise und den damit verbundenen Einschränkungen und Verunsicherungen versuchen derzeit die meisten vordringlich, ihren Alltag wieder in den Griff zu bekommen. Während vorwiegend die Jüngeren die sommerlichen Freiheiten genießen oder kompensatorisch feiern, sind für die Älteren Selbst-Stabilisierung, das Finden eines neuen Rhythmus im Corona-Alltag und Selbstwirksamkeit im vertrauten Nahbereich bedeutsam.
Insgesamt hat bei den Wähler*innen während der Corona-Zeit die Selbstbezüglichkeit zugenommen. Eine globale oder nationale Perspektive wurde weitgehend ersetzt durch den Blick auf die unmittelbare Umgebung, die Nachbarschaft, die Familie oder die eigenen Bedürfnisse. Viele haben sich sinnbildlich in ihr privates Schneckenhaus zurückgezogen. Hier drinnen finden sie Stabilität, Sicherheit und Vertrauen. Wenn sie jedoch ihre Fühler aus dem Schneckenhaus nach draußen strecken, fühlen sich derzeit die meisten fast überwältigt von der Größe und Wucht der Probleme: Flutkatastrophen, Waldbrände, wieder steigende Corona-Zahlen, vorrückende Taliban. Und neben den globalen Problemen türmen sich die nationalen Themen auf von der Frage nach bezahlbarem Wohnraum bis zur sicheren Rente, und es wächst die Sorge vor einer Spaltung der Gesellschaft.
Angesichts solcher „Jahrhundert-Herausforderungen“ verspüren die Menschen, dass ein bloßes Weiter so nicht mehr funktionieren wird, sondern große Konsequenzen erforderlich sind, die für die Einzelnen Einschränkungen und Änderungen des Lebenswandels bedeuten werden. Die damit verbundenen Einbußen und Verzichtsleistungen machen den Wähler*innen Angst. Denn sie haben keine Idee oder Plan, wie sie die anbrandenden Probleme lösen könnten. Sie stecken in einem fatalen Machbarkeits- bzw. Realisierungs-Dilemma fest: Zwar erkennen sie den dringenden Wandlungs- und Handlungsbedarf, sie sind aber gleichzeitig zu angstvoll oder zu bequem, um ihn in eine entschiedene Handlungsbereitschaft zu überführen
Das Realisierungs-Dilemma manifestiert sich derzeit in einer fast resignativen Grundstimmung. Der Abgang von Angela Merkel verstärkt diese gefühlte Ausweglosigkeit. Denn „Mutter Merkel“ versprach über 16 Jahre ein fürsorgliches und beruhigendes Weiter so. Sie stand dafür, dass man Probleme entweder alternativ- und visionslos abarbeiten oder einfach aussitzen kann. Das unwiderrufliche Ende der Merkel-Ära erhöht den ohnehin verspürten enormen Veränderungsdruck und verstärkt das aktuelle Machbarkeits-Dilemma.
Die meisten Wähler*innen leugnen nicht, dass vor allem in Sachen Klimaschutz etwas getan werden müsste, aber sie schrecken vor den damit verbundenen Herausforderungen zurück. Sie entwickeln daher meist ambivalente Strategien, um das persönliche Machbarkeits-Dilemma aufzulösen: Einerseits suchen sie eine Kandidatin oder einen Kandidaten, der bzw. die die bevorstehende Herkulesaufgabe annimmt und kraftvoll aus den Problemen herausführt. Andererseits suchen sie zu beweisen, dass es solch eine Führungsgestalt eben nicht gibt und weder Annalena Baerbock noch Armin Laschet oder Olaf Scholz dieser Aufgabe gewachsen ist: „Baerbock hat es verbockt, Laschet ist zu lasch und Scholz zu stolz.“
Die Wähler*innen investieren viel Energie und Redekunst darin, die Spitzenkandidaten regelrecht kleinzureden. Im Kern gilt dabei die CDU zwar als starke und verlässliche Partei, aber Armin Laschet als zu weich oder eben als – zu lasch. Durch sein Lachen im Flutkatastrophengebiet hat er sich nach Ansicht vieler Wähler*innen in puncto Respekt und staatsmännisches Auftreten diskreditiert. Annalena Baerbock gilt als zu jung und unerfahren, und angesichts ihrer Anfängerfehler im Wahlkampf werden Zweifel laut, dass sie die Grünen oder gar das Land hinter sich bringen kann. Scholz gilt zwar als kompetent und erfahren, und derzeit profitiert er stark von den Fehlern der anderen. Er wird jedoch mit einer Partei verbunden, die in der großen Koalition bedeutungslos geworden ist.
In der Enttäuschung der Wähler*innen, dass diesmal nur lädierte Macher*innen antreten und sich vor allem bei der CDU und bei den Grünen sich die falschen Kandidat*innen durchgesetzt hätten, schwingt jedoch oft auch eine Erleichterung mit. Die vermeintliche Schwäche der Kandidat*innen entbindet die Wähler*innen davon, selbst Stärke und Konsequenz angesichts der riesigen Herausforderungen zeigen zu müssen. Die Kleinrede-Logik setzt sich daher auch fort, wenn die Wähler*innen aufgefordert werden, sich Markus Söder oder Robert Habeck als Kanzler-Kandidaten vorzustellen. Söder wird dann zwar als „durchsetzungsstark und autoritär“ beschrieben, aber auch als unberechenbares und opportunistisches Fähnchen im Wind. Habeck gilt zwar als kompetent und ausgeglichen, aber auch als zu lieb und zu schmusig.
Die Kandidat*innen und die Parteien werden derzeit weniger im Hinblick auf konkrete Inhalte und Programmatiken wahrgenommen. Sie repräsentieren vielmehr unterschiedliche Strategien im Umgang mit dem Machbarkeits-Dilemma.
Armin Laschet und die CDU – Weiter so mit kleinen Korrekturen
Mit der CDU ist immer noch das Merkelsche Konstanz-Versprechen verbunden. Die Partei verheißt ein Weiter so ohne große Umbrüche und Einbußen. Armin Laschet als eher gutmütiger und weicher Politiker bzw. „rheinische Frohnatur“ federt große Härten ab. Seine Beweglichkeit und seine Teamfähigkeit versprechen auch eine produktive Koalition mit den Grünen und der FDP. Allerdings hat Laschet durch sein Lachen, das beinahe jede*r Wähler*in in Erinnerung hat, deutlich an Statur und Ernsthaftigkeit eingebüßt. Aus der Frohnatur ist im Blick vieler Wähler*innen eine „Witzfigur“ geworden, die vor allem auf dem außenpolitischen Parkett „mit Putin, Biden oder Macron nicht mithalten“ kann.
Die CDU-Kampagne kommt in ihrer optischen Machart meist gut kann. Der kleine Kreis versinnbildlicht das persönliche Schneckenhaus und verspricht Sicherheit und Geborgenheit. Die Offenheit des Kreises und die farbenfrohen Übergänge der Deutschlandfarben konterkarieren die Hermetik und eröffnen Spielräume für zukünftige Entwicklungen.
Annalena Baerbock und die Grünen – schöngefärbte grüne Zukunft
Die Grünen gelten als die glaubwürdigsten und eindringlichsten Mahner*innen im Kampf gegen den Klimawandel. Sie fordern in den Augen der Wähler*innen harte Konsequenzen und einschränkende Maßnahmen. Daher repräsentieren sie in den Augen aller Wähler*innen sowohl den Wandlungs-Anspruch als auch das Machbarkeits-Dilemma. Die Mahnungen und Konzepte der Grünen lassen die Menschen nicht kalt, sondern fordern sie heraus, Stellung zu beziehen und sich in einer Pro- oder Contra-Logik an der Partei abzuarbeiten.
Dadurch polarisieren die Grünen stark und werden zum Teil von den Nichtwähler*innen auch als Verzichts- oder Verbotspartei gesehen, die rigide und abgehoben sei. Durch das neue Führungsduo mit Habeck und Baerbock wirken die Grünen allerdings nicht mehr so ideologisch, streng und asketisch, sondern nahbarer und sinnenfreudiger. Den Wähler*innen ist vor allem das gute Ergänzungs-Verhältnis zwischen den beiden wichtig. Annalenas Entschiedenheit und Engagement werden durch Roberts Ruhe und Erfahrung moderiert.
Auch viele Grün-Wähler*innen geben sich moderat und wenig missionarisch. Häufig betonen sie weniger den zu leistenden Verzicht, sondern entwickeln eine fast paradiesische Vorstellung einer verkehrsberuhigten Welt voller Harmonie und im Einklang mit der Natur.
Die Kampagne der Grünen greift diesen Harmonisierungszug auf und betreibt buchstäblich grüne Schönfärberei. Robert Habeck und Annalena Baerbock stehen einträglich nebeneinander wie „Brüderchen und Schwesterchen“ oder „Adam und Eva“ und verheißen den schonenden Übergang in eine paradiesisch anmutende Zukunft.
Christian Lindner und die FDP – Fortschritt als Erlösung und Freiheitsgewinn
Christian Lindner ist in den Augen der Wähler*innen die FDP. Der Parteichef verspricht, das Machbarkeits-Dilemma aufzulösen durch die Förderung von Zukunfts-Technologien und Digitalisierung. Dadurch verkündet Lindner letztlich die verheißungsvolle Botschaft, dass der Mensch sein Leben nicht großartig umstellen müsse, sondern die technologische Innnovationskraft der deutschen Wirtschaft die Probleme lösen könne.
Lindner gilt als Antagonist zu den „übervernünftigen“ Forderungen und moralischen Gewissensappellen der Grünen. Er fasziniert die Wähler*innen nicht nur durch seinen jungenhaften Charme und seine Rhetorik, sondern durch sein Freiheits- und Entlastungs-Versprechen. Er repräsentiert angesichts der großen Herausforderungen und Mahnungen das innere Kind der Wähler*innen, das sich auch einmal trotzig querstellen kann, sich aus der Verantwortung stehlen oder selbstverliebt agieren kann. Lindners auch in der FDP-Kampagne mitunter „narzisstisch“ anmutende Selbstdarstellung gibt seinen Wähler*innen auch die Erlaubnis, sich Spiel- oder Freiräume für die eigene Selbstbezüglichkeit zu eröffnen.
Olaf Scholz und die SPD – konstantes Abarbeiten und große finanzielle Überbrückungshilfen
Olaf Scholz war zu Beginn des Wahlkampfes der unsichtbare Dritte. Die Wähler*innen erlebten ihn als „unscheinbar, kühl, leblos und akademisch“. Seit Armin Laschets Lach-Fauxpas avanciert Scholz zusehends zum lachenden Dritten, eben weil er nicht lacht. Jetzt treten seine „Kompetenz, Seriosität und Staatsmännigkeit“ stärker in den Blick. Das mit der CDU verbundene Konstanz-Versprechen löst Scholz in den Augen der Wähler*innen nun am besten ein. Durch seine „kühle, zurückhaltende Art“ wird er häufig als der geeignetste Merkel-Ersatz gesehen. Das Machbarkeits-Dilemma mildert er ab durch eine Mischung von „emsigem Abarbeiten bzw. Abtragen des Problembergs“ und dem Auspacken der „Finanz-Bazooka“, mit der man möglicherweise die größten Wandlungs-Härten abmildern könnte.
Allerdings wird Olaf Scholz von vielen nicht unmittelbar mit der SPD in Verbindung gebracht. Die Wähler*innen haben ihn zwar auf dem Zettel, werden ihn jedoch auf dem Wahlzettel nicht finden. Die SPD konterkariert trotz oder wegen ihrer Beteiligung an der großen Koalition das Merkelsche Konstanzversprechen, denn als Partei ist sie im Bündnis mit der Union zusehends diffundiert: Alle sozialen Initiativen werden auf Merkels Konto verbucht. Die SPD steht eher für interne Querelen und nicht eingelöste Versprechen. Sie wird oft immer noch spontan mit dem „Verrat der Arbeiter“ durch die Agenda 2010 und Hartz IV verbunden.
AfD – Zukunft bedeutet die Rückkehr zur „Normalität“
Den Wähler*innen ist oft unklar, wer das aktuelle Spitzenpersonal der AfD ist. Als Partei dient sie oft als Projektionsfläche für all das, was in der Politik oder auch im eigenen Leben schiefgelaufen ist und dringend geändert werden müsste. Die AfD ist daher für viele eine Alternative oder ein Auffangbecken, die sich nicht gesehen, nicht respektiert fühlen oder den Eindruck haben, dass die Politik ihre Alltagssorgen nicht im Blick hat. Mit der Wahl der AfD will man den anderen Parteien einen Denkzettel erteilen, aber auch der Sehnsucht nach starker Führung, Bindung, klaren Regeln und Normen Ausdruck verleihen.
Die AfD hebt das Machbarkeits-Dilemma auf, indem sie die globalen Probleme (Klimawandel, Pandemie) verleugnet oder kleinredet. Sie beschwört vor allem in ihrer sehr wirksamen und als alltagsnah erlebten Kampagne die Wiedererrichtung eines deutschen Normalitäts-Maßes. Damit suggeriert sie den Wähler*innen, dass Deutschland nicht an den großen Weltproblemen leidet, sondern an den kleinen und selbstgemachten Problemen des political correctness, des Genderns, der Migration und der Multi-Kulti-Idealisierung, der Auflösung der traditionellen Rollenmuster oder der Klima-Hysterie. Die AFD verspricht den Wähler*innen angesichts einer unübersichtlich gewordenen Welt die Rückkehr in ein „überschaubares und vertrautes Deutschland“ in dem „die Welt noch in Ordnung war“. Unklar bleibt mitunter dabei, ob diese Rolle rückwärts in die 80er, die 60er, oder die 30er Jahre führt.
Die Linke – keine Antwort auf das Machbarkeits-Dilemma
Viele Wähler*innen haben die Linke nicht auf dem Schirm, und die Partei scheint in den Augen der Bürger*innen auch keine stimmige Strategie im Machbarkeits-Dilemma aufzuweisen. Das Spitzenpersonal ist selbst unter den Links-Wähler*innen kaum bekannt. Viele verbinden noch Gregor Gysi oder Sarah Wagenknecht mit der Partei. Insgesamt wirkt die Partei so führungs- und konzeptionslos. Lediglich die Stammwähler*innen bekennen sich klar zur Linken.
Mit einigen Forderungen wie dem Mindestlohn von 13 Euro kann die Linke zwar punkten, aber sie steht oft eher für „intellektuelle Realitätsferne“ oder „ideologischen Trotz“. So weckt sie weniger die Hoffnung nach sozialer Gerechtigkeit, als dass sie Verlustängste schüren. Eine von vielen potenziellen Links-Wähler*innen als notwendig erachtete Umverteilung wird derzeit durch die Sorge einer wirtschaftlichen Schwächung Deutschland überlagert.
Die Wähler*innen entwickeln einen Nimm 2- oder Nimm 3-Logik, um das Machbarkeits-Dilemma auszutarieren
Dezidierte Wahlprognosen sind derzeit fast unmöglich, denn viele Wähler*innen sind derzeit noch unentschlossen. Angesichts des Machbarkeits-Dilemmas fällt es ihnen schwer, sich auf eine Partei und damit einen möglichen Lösungsweg aus dem Dilemma festzulegen. Wie bei keiner Wahl zuvor denken die Bürger*innen daher in Koalitionen. Viele würden ihre Stimmen am liebsten splitten, um ein eigenes Koalitions-Süppchen zu kochen.
Meist enthält das individuelle Koalitions-Rezept dabei drei Bestandteile:
- Die CDU und mittlerweile auch Olaf Scholz stehen für Konstanz und für ein bewegliches Weiter so.
- Die Grünen sollen den Wandlungs-Anspruch aufgreifen und moderate Anstrengungen gegen die Klimakrise umsetzen.
- Die FDP soll dafür einstehen, dass dabei persönliche Frei- und Spielräume erhalten bleiben.